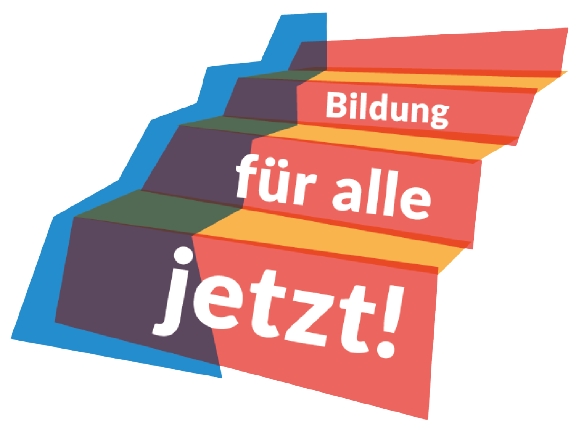Toolbox: Den Zugang zur Regelschule für alle Kinder auf kantonaler Ebene vorantreiben!
Das Ziel dieser Toolbox ist es, Wege aufzuzeigen, wie Sie als Gruppe oder Einzelperson das Recht auf Bildung für ALLE oder ein anderes Thema, das Demokratie und Zusammenleben fördert, in Ihrem Kanton vorantreiben können.
Demokratie bedeutet auch, dass die Bevölkerung auf allen Entscheidungsebenen beteiligt wird. Manchmal werden bestimmte Probleme von den zuständigen Behörden nicht erkannt, weil ihnen schlichtweg die Perspektive der Betroffenen fehlt. In solchen Fällen ist ein Dialog zwischen der Bevölkerung und den Entscheidungsträger*innen notwendig. Manchmal können Lösungen gemeinsam gefunden werden!
Viele Entscheidungen in Bezug auf die Bildungs- und Integrationspolitik werden in der Schweiz auf kantonaler Ebene getroffen. Entscheidungen zur Grundschulbildung regeln die Kantone und Gemeinden gemeinsam. Die Kantone sind dabei hauptverantwortlich. Im Bundesparlament kann in diesem Politikbereich nicht viel erwirkt werden.
Deshalb braucht es in allen Kantonen lokal angepasste Kampagnen und Massnahmen, damit Kinder aus dem Asylbereich endlich Zugang zur Regelschule haben.
Dazu stellen wir hier Hilfsmittel zur Verfügung.




-
Was ist das Problem?
Stellen Sie sich die Frage, welche Probleme in Ihrem Kanton in Bezug auf den Zugang zur Regelschule existieren. Seien Sie dabei möglichst konkret. Möglicherweise ist zur Identifikation der Probleme bereits eine kleine Recherche nötig.
- Einen Überblick über 13 Problemfelder, die sich in verschiedenen Kantonen finden, finden Sie in unserem Bericht auf S. 10–13 .
- Eine Liste mit nützlichen Fragen zur Situation in Ihrem Kanton finden Sie hier .
- Behörden in der Schweiz sind grundsätzlich dazu verpflichtet, Auskunft auf Anfragen aus der Bevölkerung zu geben. Sie können mit Verweis auf das Öffentlichkeitsgesetz bei den Behörden Informationen einholen. Eine einfache E-Mail mit konkreten Fragen reicht oft aus. Weitere Infos: Details zum Öffentlichkeitsgesetz .
Welche Lösungen leiten Sie daraus ab?
Suchen Sie für jedes Problem eine passende Lösung und notieren Sie diese. Denken Sie gerne “utopisch” – schränken Sie sich nicht direkt durch Machbarkeit ein.
Nützliche Tools:
-
Forderungen definieren
Ausgehend von den erarbeiteten Problemen und Lösungen können Sie nun Ihre Forderungen definieren. Werden Sie in Ihren Formulierungen möglichst konkret. Es ist auch hier wichtig, sich nicht gedanklich einschränken zu lassen. Haben Sie keine Angst vor Maximalforderungen. Veränderungen sind immer Aushandlungsprozesse und Sie werden Gelegenheit haben, sich in Diskussionen die Seite der Behörden anzuhören.
- In unserem Bericht auf S. 20–21 finden Sie die Forderungen, die “Bildung für alle – jetzt!” kantonsübergreifend formuliert hat. Einige dieser Forderungen sind in Ihrem Kanton möglicherweise bereits umgesetzt. Sie können daraus die Forderungen, die für Ihren Kanton nicht umgesetzt sind, filtern und sie für Ihre möglichen Ziele auf Kantonsebene umformulieren.
Welche Botschaft will ich vermitteln?
Sie können Ihre Botschaft auch kurz mündlich in Ihrem Umfeld “testen”.
-
Was weiss ich über den Kontext?
Klären Sie als nächstes, was Sie über den Kontext wissen. Stellen Sie sich diese Fragen:
- Wurden bereits Bemühungen unternommen, die in dieselbe Richtung gehen wie Ihre Forderungen? Von wem? Wann?
- Was war erfolgreich, was nicht? Weshalb?
Wer kann auf behördlicher Ebene die Veränderung bewirken?
Wer ist bereits in dem Bereich aktiv und kann meine Anliegen unterstützen?
- Welche Organisationen oder Politiker*innen sind im Bereich Asyl und Bildung tätig?
- Welche zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren sich in Ihrer Region für die Rechte von Menschen aus dem Asylbereich? Wer könnte Sie unterstützen?
- Welche Kontakte haben Sie? Wer könnte Ihnen Kontakt verschaffen?
Nützliche Tools:
- Stakeholderanalyse
- Power Map
-
Nun können Sie zur Aktion schreiten. Hier finden Sie eine Liste möglicher Massnahmen, sowie hilfreiche Tipps dazu, wie Sie diese einsetzen können. Es ist nicht notwendig (und meist auch nicht möglich) alle dieser Massnahmen umzusetzen – konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine oder zwei Massnahmen, die Ihnen sinnvoll und mit Ihren Ressourcen umsetzbar erscheinen. Wenn Sie mehrere Massnahmen umsetzen, machen Sie sich Gedanken zur Reihenfolge. Beispielsweise macht es oft Sinn, zuerst den Dialog mit den Behörden zu suchen bevor Sie Parlamentarier*innen oder die Medien kontaktieren.
-
Die Behörden um einen Austausch zu bitten, kann hilfreich sein, um die Position der Behörden besser kennenzulernen und sie für euer Anliegen zu sensibilisieren.
Was kann man sich von einem Treffen mit den Behörden erhoffen?
In erster Linie geht es in einem Gespräch mit den Behörden darum, sie über die Problematik zu informieren. Vielleicht wissen die Behörden bereits Bescheid, sind aber nicht über alle Aspekte des Problems informiert. Oder sie wissen nicht, wie weitreichend die Folgen für die Betroffenen sind. Die Informationen, die Sie den Behörden zu diesem Thema geben können, sind wertvoll.
Ein Treffen kann Ihnen auch dabei helfen, den Handlungsspielraum Ihrer Gesprächspartner*innen zu verstehen und mehr über deren Bereitschaft, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, herauszufinden.
Format
Je nach Situation macht es Sinn, die Behörden direkt nach einem Austauschformat zu bitten. Folgende Formate können sich für einen Austausch mit den Behörden eignen:
- direktes Gespräch
- runder Tisch zwischen Behörden, Betroffenen, Organisationen der Zivilgesellschaft
- Einsetzen einer Arbeitsgruppe zum Thema (falls keine Vorhanden ist) oder Einbezug in einer Arbeitsgruppe zum Thema (falls bereits eine besteht)
Was muss man vorbereiten?
Es ist wichtig, die Diskussion über einen sachlichen Aspekt zu führen. Beschreiben Sie das Problem so objektiv wie möglich. Häufig haben die Behörden ohne Vorbereitung nicht alle Informationen zu dem Thema, das Sie ansprechen möchten, zur Hand. Daher ist es sinnvoll, vor dem Treffen ein kleines Dossier mit den Informationen, die Sie haben, und einer Liste von Fragen, die Sie von den Behörden beantwortet haben möchten, vorzuschlagen.
Präsentieren Sie die Informationen, die Sie haben, auf sachliche Weise. Beschreiben Sie, was Sie beobachten, und erklären Sie objektiv, warum dies ein Problem darstellt. Objektivität bedeutet nicht, dass die Emotionen oder die Personen, die die problematische Situation erleben, unsichtbar gemacht werden sollten. Sie können Ihr Dossier durchaus mit Zeugenaussagen ausschmücken. Dies ermöglicht es den Behördenmitgliedern außerdem, andere Dimensionen des Problems zu verstehen und sich möglicherweise mit den Betroffenen zu identifizieren. Viele Personen sind selbst Eltern und haben Kinder, die zur Schule gehen.
Wer sollte zu einem Gespräch mit den Behörden mitkommen?
Wenn Ihre Gruppe aus verschiedenen Organisationen besteht, ist es wichtig, dass diese nach Möglichkeit vertreten sind. Wenn Sie eine betroffene Person sind, ist Ihre Anwesenheit sehr wichtig. Es ist jedoch legitim, Befürchtungen zu haben, sich an eine Behörde zu wenden, die auch für die Bearbeitung Ihres Asylantrags oder Ihre administrative Situation zuständig ist. Diese Ängste sind völlig legitim und sollten ernst genommen werden. Sprechen Sie mit anderen darüber und lassen Sie sich begleiten oder vertreten, wenn Sie sich dadurch sicherer fühlen.
Teilen Sie den Behörden vorab mit, wie sich Ihre Delegation zusammensetzt. Geben Sie an, wer kommt und in welcher Funktion. Bitten Sie die Behördenvertreter*innen, Ihnen ebenfalls mitzuteilen, wer in welcher Funktion anwesend sein wird. Wenn Sie sich in der Amtssprache nicht sicher fühlen, sorgen Sie dafür, dass eine Übersetzung durch eine Vertrauensperson sichergestellt ist.
-
Das Petitionsrecht ermöglicht es Personen, sich an die jeweilig zuständige Behörde zu wenden. Es ermöglicht, eine Bitte, Anregung oder Beschwerde schriftlich zu formulieren. In der Regel werden andere Personen gebeten, die Petition durch ihre Unterschrift zu unterstützen. Durch die Anzahl der Unterschriften kann die Bedeutung des Anliegens hervorgehoben werden, was zeigt, dass viele Menschen betroffen sind oder sich betroffen fühlen.
Jede Person kann eine Petition unterzeichnen, man muss weder volljährig sein noch einen bestimmten Aufenthaltsstatus besitzen.
Eine Petition hat an sich keinen rechtlichen Wert. Die Behörden sind verpflichtet, sie zur Kenntnis zu nehmen, nicht aber, darauf zu reagieren. Eine Petition allein wird in der Regel nicht direkt eine Änderung der Praxis der Behörden bewirken. Andererseits ist sie ein sehr guter Ausgangspunkt, um die Aufmerksamkeit der Behörden und der Öffentlichkeit auf ein bestimmtes Problem zu lenken.
Eine Petition in der Phase der Unterschriftensammlung ist zudem ein hervorragendes Kommunikationsmittel. Sie ermöglicht es den Menschen, sich von der Situation betroffen zu zeigen, und gibt ihnen eine einfache und effektive Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Außerdem ermöglicht sie es interessierten Personen, mit Initiant*innen der Petition in Kontakt zu bleiben, z. B. durch das Sammeln von E-Mail-Adressen.
Eine Petition kann auf Papier ausgedruckt und die Unterschriften physisch gesammelt werden, oder die Unterschriften werden online gesammelt. Am besten ist es, wenn man beide Möglichkeiten anbietet.
Die folgenden Plattformen bieten die Möglichkeit, Online-Petitionen zu erstellen. Sie unterscheiden sich darin, wie die Plattform die Initiant*innen begleitet:
Beispiel einer Petition:

Einreichen der Petition
Auf der Petition ist es in der Regel sinnvoll, eine Frist anzugeben, damit Sie genügend Zeit haben, die Unterschriften zu zählen.
Der Zeitpunkt der Übergabe der Petition ist ebenfalls wichtig. Man kann die Unterzeichner*innen und die Presse zur Überreichung der Unterschriften einladen. Man sollte Redebeiträge einplanen und Fotos machen, um sie später in den Netzwerken zu verbreiten. Schließlich sollten die Unterzeichner*innen, deren Adressen gesammelt wurden, über die Einreichung der Petition informiert werden.
Bei der Einreichung einer Petition auf Bundesebene kann sie entweder an das Parlament oder an die Regierung gerichtet werden. Wenn sie an das Parlament gerichtet ist, wird sie an die zuständige Kommission weitergeleitet
-
Um die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen, ist es wichtig, die Zielgruppe richtig zu wählen. Für Themen, die Menschen betreffen, die in der Region leben, sind lokale Medien am relevantesten.
Es ist wichtig, herauszufinden, welche Journalisten an welchen Themen arbeiten und wie man mit ihnen in Kontakt treten kann. Auf den Websites der Redaktionen sind in der Regel die Ressortleiter mit ihren E-Mail-Adressen oder sogar direkten Festnetznummern angegeben. Auch hier sind zwischenmenschliche Kontakte von Vorteil.
Pressekonferenz
Eine Pressekonferenz macht Sinn, wenn Sie mehrere Informationen zu kommunizieren haben und verschiedene Perspektiven vertreten werden sollen. Zu einer Pressekonferenz zu reisen und dort länger zu bleiben, ist im Alltag von Journalist*innen eine zeitraubende Aktivität. Die Entscheidung, ob sie kommen oder nicht, hängt daher von der Bedeutung des Themas, dem ungewöhnlichen Blickwinkel des Ansatzes und der Möglichkeit ab, dass sie einen Artikel schreiben oder eine relevante Reportage machen können. Die Pressekonferenz sollte kurz, aber informativ sein. Es sollte auch eingeplant werden, dass Journalist*innen bei Bedarf Einzelinterviews nach der Konferenz führen können.
Zur Pressekonferenz einladen
Die Einladung zur Pressekonferenz sollte frühzeitig, aber auch nicht zu früh verschickt werden. In der Regel planen die Redaktionen ihre Arbeit für die Woche am Montag. Sie können Ihre Einladung (siehe unten: Pressemitteilung) am Montag der Woche vor Ihrer Konferenz versenden. Schicken Sie dann am Montag der betreffenden Woche eine Erinnerung. Sie können auch sicherstellen, dass die Journalisten kommen, indem Sie die Redaktionen telefonisch kontaktieren. Auch hier sind persönliche Kontakte von Vorteil.
Pressedossier
Damit sich die Journalist*innen auf die Pressekonferenz vorbereiten können, aber auch alle Informationen haben, die sie für ihre Artikel nach der Konferenz benötigen, ist ein gutes Pressedossier von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie nicht möchten, dass die Infos aus Ihrem Pressedossier bereits vor der Konferenz veröffentlicht werden, können Sie eine “Sperrfrist” angeben.
- Inhaltsverzeichnis des Pressedossiers
- Titelseite mit dem Namen der Organisation und der in wenigen Worten zusammengefassten Hauptbotschaft. Kontaktangabe der Mediensprecher*in für eventuelle Rückfragen.
- Eine Zusammenfassung des Hintergrunds bzw. eine Chronologie der Ereignisse, die zur Pressekonferenz führten
- Eine kurze Vorstellung des Verbands oder der Gruppe von Verbänden, die die Pressekonferenz initiieren
- Die Texte der Redebeiträge der Personen, die auf der Konferenz sprechen werden.
- Ev. direkte Zitate, die von Journalist*innen unverändert übernommen werden können.
Wo soll eine Pressekonferenz stattfinden?
Wählen Sie einen Ort, der gross genug, aber nicht zu laut ist. Achten Sie darauf, dass er nicht zu weit von den Redaktionen der Medien entfernt ist. Sie können auch einen symbolischen Ort wählen, der mit Ihrem Vorhaben in Verbindung steht. Oft illustrieren Journalist*innen ihre Artikel oder Reportagen mit Fotos von der Pressekonferenz. Behalten Sie diesen Aspekt bei der Wahl des Ortes im Hinterkopf.
Wer spricht bei einer Pressekonferenz?
Eine klar definierte Person übernimmt die Moderation. Sie begrüßt die Journalist*innen und stellt die Rednerinnen und Redner vor.
Jede*r Redner*in sollte einen direkten Bezug zum behandelten Thema haben, ein Fachwissen, das klar erkennbar sein muss. Jede Person sollte sich im Gespräch mit der Presse wohlfühlen und in der Lage sein, spontan auf Fragen von Journalisten zu antworten. Um die Konferenz kurz und interessant zu halten, sollten idealerweise nicht mehr als drei Redner*innen anwesend sein.
Medienmitteilung

Eine Medienmitteilung dient dazu, Journalist*innen über Neuigkeiten zu informieren, mit einer Stellungnahme auf eine Nachricht zu reagieren, eine bevorstehende Aktion anzukündigen oder umgekehrt, z. B. die bisherige Arbeit Ihrer Organisation vorzustellen.
Man muss sich vor Augen halten, dass Journalist*innen täglich sehr viele Nachrichten wie beispielsweise Agenturmeldungen, offizielle Stellungnahmen von Parteien oder Organisationen erhalten. Es ist wichtig, einen Weg zu finden, um aus der Masse herauszustechen.
Wie man eine Medienmitteilung verfasst
Eine Pressemitteilung muss kurz, klar und eingängig sein. Die Journalist*innen müssen auf einen Blick erkennen können, worum es geht. Name, Titel, Datum, Überschrift, Fakten, Zitat, Kontaktperson (Konten in sozialen Netzwerken). Ein Satz = eine Idee, zwischen 2500 und 4500 Zeichen. Eventuell ein Foto, im Hauptteil des Textes, mit Credits. Kann mit einer Pressemappe ergänzt werden.
Social-Media Posts
Wann und wie macht Social Media Sinn?
Social-Media Posts können als Begleitmassnahme zu Ihren sonstigen Aktivitäten Sinn machen. Sie sind ein einfacher Weg, um Online Aufmerksamkeit für Ihr Anliegen zu generieren. Allerdings nur, wenn Sie bereits über ein Netzwerk verfügen. Wenn Sie nicht bereits mit einer Organisation und einem breiten Netzwerk auf Social-Media vertreten sind, macht es mehr Sinn, auf Organisationen zurückzugreifen, die dies bereits haben. Bitten Sie diese Organisationen (beispielsweise “Bildung für alle - jetzt!”) dazu, zu Ihrem Anliegen zu posten.
Was soll ich posten?
Posten Sie aktuelle Informationen, Medienartikel, Porträts von Betroffenen und sogenannte “calls to action”, falls Sie beispielsweise Unterschriften für eine Petition sammeln. Wichtig ist, dass Sie Ihre Posts anschliessend an verbündete Personen und Organisationen schicken, damit diese ihre Posts weiterverbreiten. Posten Sie möglichst regelmässig. Je öfter Sie zu Ihrem Thema posten, desto mehr Menschen erreichen Sie.
Welches soziale Netzwerk für welches Publikum?
Via Linked-In erreichen Sie vor allem ein professionelles Netzwerk. Facebook und Instagram haben die grösste Reichweite und lassen sich verknüpfen. Andere Netzwerke (X, TikTok) sind für die Anliegen zur Beschulung weniger geeignet.
Unsere Social-Media Kanäle:
- Bildung für Alle - jetzt! auf Instagram
- Bildung für alle - jetzt! auf Facebook
- Bildung für alle - jetzt! auf Linked-In
Mit Hate Speech umgehen: https://stophatespeech.ch/
-
Finden Sie heraus, mit welchen Parlamentarier*innen Sie Kontakt aufnehmen können
Welche Politiker*innen/Parteien arbeiten zu den Themen, die Sie betreffen? Versuchen Sie herauszufinden, wer in den Parteien über Fachwissen oder Sensibilität für Ihr Anliegen verfügt.
Auf den Webseiten der verschiedenen Parlamente finden Sie eine Liste der jeweils gewählten Abgeordneten, geordnet nach Partei und Region. Es ist auch möglich, mehr über ihren Beruf und ihre Interessenbindungen zu erfahren, sowie über die Verbände oder Institutionen, denen sie angehören.
Hier ein Beispiel für das Kantonsparlament von Schaffhausen
Wie kann man sie kontaktieren?
Es ist viel effektiver, Parlamentarier*innen direkt anzusprechen, wenn zwischenmenschliche Kontakte bestehen. Vielleicht ist eine Abgeordnete in derselben Fussballmannschaft wie ein Mitglied Ihres Kollektivs? Versuchen Sie, herauszufinden, ob möglicherweise Verbindungen über gemeinsame Bekannte bestehen.
Wenn es keine solchen Verbindungen gibt, können Sie sich per E-Mail direkt an die Parlamentarier*innen wenden. Ihre offizielle Adresse finden Sie in der Regel auf der Website des jeweiligen Rates. Es gibt auch die Möglichkeit, Post zu schicken. Vermeiden Sie jedoch die Kontaktaufnahme via Privatadresse (ausser Sie kennen die Person). Dies kann als aufdringlich empfunden werden.
Erklärvideo von Anna Rosenwasser
Beispiel für einen Brief an eine*n gewählte*n Politiker*in: Herunterladen
Parlamentarische Vorstösse vorschlagen
Es gibt verschiedene parlamentarische Instrumente, die gewählten Politiker*innen zur Verfügung stehen. Sie unterscheiden sich nach dem Grad der Bedingungen, unter denen sie im Rat vorgeschlagen werden können, und im Grad der Einschränkung, die der Exekutive in der Umsetzung vorgegeben sind. Eine Interpellation oder eine Anfrage erfordert beispielsweise nur eine kurze, schriftliche oder mündliche Antwort der Regierung. Sie können von einem oder mehreren Parlamentarier*innen ohne Abstimmung im Rat eingebracht werden. Eine parlamentarische Initiative hingegen verlangt von der Regierung die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs und muss eine Mehrheit im Rat erhalten, um an die Regierung gerichtet zu werden.
Liste der parlamentarischen Geschäfte auf Bundesebene (mit Links zum Parlamentswörterbuch)
- Interpellation
- Anfrage
- Postulat
- Motion
- Parlamentarische Initiative
- Kantonale Initiative
- Kommissionsinitiative
Auf kantonaler Ebene haben die parlamentarischen Vorstoss-Arten eine ähnliche Klassifizierung, ihre Namen können jedoch variieren. Je nach Kanton verfügen die Webseiten der Parlamente auch über ein Lexikon oder zumindest über eine Liste der Vorstoss-Arten. Hier die Beispiele aus den Kantonen Neuenburg und Basel-Stadt .
-
Wenn ein Kind nicht innerhalb von einer sinnvollen Frist in die Regelschule eingeschult wird, kann dagegen Beschwerde eingereicht und allenfalls juristisch vorgegangen werden. Faustregel ist ein Übertritt aus einer besonderen Klasse in die Regelschule spätestens nach einem Jahr, besser schon früher. Wichtig ist, dass das Begehren der Einschulung in die Regelschule von den Eltern ausgehen sollte und ihrem Willen entspricht.
Die Schritte die sie für eine Beschwerde einleiten müssen sind:
- Das Gespräch mit der Lehrperson und den Schulbehörden suchen und sie darum bitten, dass das Kind in die Regelschule übertreten kann.
- Falls dem Wunsch nicht stattgegeben wird, ein schriftliches Gesuch nach Übertritt in die Regelschule einreichen (siehe Muster unten). In dem Gesuch nach einer schriftlichen, anfechtbaren Verfügung bitten.
- Innerhalb der angegebenen Frist Rekurs resp. Beschwerde bei der entsprechenden Stelle einreichen (siehe Muster unten).
Hier finden Sie Mustervorlagen für ein Gesuch und eine Beschwerde. Wichtig: Gesuch und Beschwerde müssen 1) den individuellen Gegebenheiten des Kindes 2) der individuellen Begründung der Schulbehörde und 3) der kantonal jeweils unterschiedlichen gesetzlichen Grundlage angepasst werden.
Nützliche Links:
Auf der Seite des Konsumentenschutzes finden Sie mehr Informationen zum Einreichen einer Beschwerde.
-
Veranstaltungen zu organisieren kann als Vorbereitungs- oder Begleitmassnahme zu ihren sonstigen Aktivitäten Sinn machen. Wichtig ist es, viel in die Mobilisierung zu investieren, damit Sie ein möglichst grosses Publikum erreichen.
Als Faustregel gilt, dass Sie mindestens 1 Monat Zeit brauchen, um die Veranstaltung zu bewerben. Das bedeutet, dass alle Informationen zur Veranstaltung mindestens 1 Monat vorher festgelegt sein müssen. Veranstaltungen können der Sensibilisierung, der Wissensgenerierung, der Vernetzung oder der Generierung von Aufmerksamkeit in Medien und Öffentlichkeit dienen. Überlegen Sie sich, welche(n) dieser Zweck(e) Ihre Veranstaltung verfolgt und laden Sie entsprechend die wichtigsten Personen zur Erreichung dieses Zwecks ein. Oft macht es Sinn, Entscheidungsträger*innen aus den Behörden einzuladen - auch wenn sie nicht erscheinen, sind sie dadurch informiert, dass Sie sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen.
Hier eine Auflistung möglicher Veranstaltungsformate:
- Diskussion
- Podiumsdiskussion
- Vortrag mit anschliessender Diskussion
- Informationsveranstaltung
- praktische Workshops
- World-Café
- Konferenzen, Kongress, Tagung
- Pressekonferenz (siehe Punkt C zu Medienarbeit)
- Kundgebung
Nützliche Links:
-
-
1. Die rechtlichen Grundlagentexte
Diese Texte müssen nicht im Detail studiert werden, können aber je nach Kontext hilfreich sein.
Bundesverfassung
- Niemand darf diskriminiert werden. (BV, Art. 8)
- Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (BV, Art. 19 und Art. 62 Abs. 2)
- Bund und Kantone tragen den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung. (BV, Art. 67)
UNO Pakt I
Rechte der Kinder (UNO-Kinderrechtskonvention)
- Art. 2 – Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot
- Art. 3 – Das Wohl des Kindes ist vorrangig zu berücksichtigen
- Art. 28 – Recht auf Bildung: Grundschule und Förderung des Zugangs
Standards hinsichtlich Zugang und Ausgestaltung des Grundschulunterrichts sind beispielsweise in den allgemeinen Kommentaren des UNO-Kinderrechtsausschusses enthalten (siehe CRC/GC/2005/6, Ziff. 41; CRC/GC/2001/1, Ziff. 3.).
Die Volksschulgesetze und -verordnungen unterscheiden sich je nach Kanton und können via Suchmaschine gefunden werden. Hier beispielsweise die des Kantons Bern.
Die Nothilfeweisungen unterscheiden sich je nach Kanton und können via Suchmaschine gefunden werden. Hier beispielsweise die des Kantons Bern unter dem Punkt Nothilfeweisung.
2. Nützliche Texte
Diese Texte können inhaltlich zum Thema “ALLE Kinder in die Schule” hilfreich sein.
- Bildung für alle - jetzt (2024) : Wenn das Recht auf Bildung nicht für alle gilt. Eine Bestandsaufnahme zur Situation der Einschulung von Kindern aus dem Asylbereich. Bern.
- Amarelle, Cesla und Zimmermann, Nesa (2024) : Das Nothilferegime und die Rechte des Kindes. Rechtsgutachten und Studie zur Vereinbarkeit mit der schweizerischen Bundesverfassung und der Kinderrechtskonvention. Herausgegeben von der Eidgenössischen Migrationskommission EKM. Bern.
- Heiniger, Tobias (2021) : Zugang zu Bildung unabhängig vom Aufenthaltsrecht. Herausgegeben von der Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA). Bern.
- Lannen, Patrizia; Paz Castro, Raquel; Sieber, Vera (2024) : Kinder in der Nothilfe im Asylbereich. Systematische Untersuchung der Situation in der Schweiz. Herausgegeben von der Eidgenössischen Migrationskommission EKM. Bern.
3. Nützliche Kontakte
Organisationen auf nationaler Ebene
- Bildung für alle - jetzt!
- Das Flüchtlingsparlament
- Solidarité sans frontières
- VPOD Verbandskommission Migration
- VSS Perspektiven Studium
Organisationen auf kantonaler Ebene
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Ihnen allenfalls nützliche Kontakte in Ihren Kanton vermitteln können.